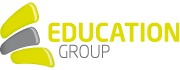Psychologische Gesundheitsförderung
Das Buch gliedert sich in drei große Abschnitte: Diagnostik gesundheitlicher Ressourcen und Risiken, Methodische Ansätze und Gesundheitspsychologische Prävention: Ressourcenstärkung und Risikoprophylaxe.
Buchtitel: Psychologische Gesundheitsförderung. Diagnostik und Prävention
Autorinnen: Jerusalem M u Weber H
Verlag: Göttingen: Hogrefe
Erschienen: 2003
Irgendwer hat den Vergleich angestellt, dass im angelsächsischen Sprachraum eher das Wohlbefinden im Zentrum der Gesundheitsdefinition stünde, während im deutschen Sprachraum die Einhaltung von Normwerten zentral wäre. Wer immer dies behauptet hat, er oder sie hat das erste Kapitel in diesem Buch nicht gelesen: Hier dominiert das Wohlbefinden in seiner Bedeutung, ob man es durch Regulationskompetenz, Sinnfindung oder Selbstaktualisierung erreicht, ob durch emotionale, kognitive oder handlungsbezogene Komponenten – immer ist Wohlbefinden die wichtige Ergänzung zur Funktionstüchtigkeit und zum allgemeinen körperlichen Zustand. Die Vorrangstellung des Wohlbefindens gegenüber der Normeinhaltung zeigt sich auch in der Begründung qualitativer Diagnoseverfahren als notwendige Ergänzung zu quantitativen Methoden (die u.a. auch oft auf additiven, elementarisierenden Messmodellen beruhen und auch nicht unbeeinflusst von Tendenzen zur Selbstdarstellung im sozial erwünschten Sinn bleiben). Das zweite Kapitel befasst sich mit gesundheitsbezogenen Zielen und Erwartungen. Hier besonders interessant das referierte Konzept der possible selves, das sind gewünschte oder gefürchtete Zukunftsvorstellungen, die eigene Person betreffend. Bei Untersuchungen stellte sich heraus, dass bei älteren Befragten vielfach gesundheitsbezogene Antworten erfolgten, wobei die Angst vor Krankheit stärkere Wirkung zeigte als der Wunsch nach Gesundheit. Das dritte Kapitel befasst sich mit gesundheitsrelevanten Persönlichkeitsmerkmalen, seien dies emotionsbezogene oder kontrollorientierte Persönllichkeitsvariabeln oder Bewältigungsdispositionen oder emotionale und physiologische Reaktionen oder gesundheitsrelevante Aktionen wie z.B. das Risikoverhalten bzw. das Gesundheitsverhalten. Interessant auch die Ausführungen zur negativen Affektivität und ihren gesundheitlichen Folgen und die kritischen Notizen zu Konzepten der Resilienz (hardiness, Kohärenz) Ein weiteres Kapitel beschäftigt sich mit subjektiven Theorien von Gesundheit und Krankheit. Eine Überblicksgrafik auf Seite 62 umfasst die Kontexte Lebenswelt, Biografie und Selbstkonzept-Lebenskonzept, weiteres die Einflussbereiche und Einflussprozesse der subjektiven Gesundheitstheorien und der subjektiven Krankheitstheorien, und als Innenbereich die jeweiligen Konzepte zu Gesundheit und Krankheit. Im Weiteren wird dieser Überblick entfaltet. Als Beispiel seien die originellen Gesundheitskonzepte auf Seite 66 angeführt: Das Schalter-Modell (Gesundheit ist da oder nicht da), das Batterie-Modell (Gesundheitspotentiale nehmen mit dem zunehmenden Alter ab), das Akkumulator-Modell (teilweise lässt sich Gesundheit wieder auffüllen) und das Generator.Modell (Gesundheit kann unter Umständen sogar wachsen). Spätestens seit der Risikofaktor „Einsamkeit, Isolation“ formuliert wurde, ist der Inhalt des letzten Kapitels von Teil I wichtig: Die Berücksichtigung von sozialer Unterstützung. Nach grundsätzlichen Überlegungen bringen die Seiten 99 bis 104 einen detaillierten Überblick über Verfahren zur Diagnostik von allgemeiner und spezifischer sozialer Unterstützung.
Der zweite Abschnitt referiert über methodische Ansätze, seien dies nun Veränderungsmessungen (hier wird unterschieden zwischen situationsspezifischen, situationsübergreifenden, manifesten und latenten, interindividuellen und intraindividuellen Veränderungen) und Kausalanalysen, seien es Qualitätssicherung und Evaluation (hier wird neben der bekannten Unterscheidung zwischen formativer und summativer Evaluation eine interessante Differenzierung zwischen Wirksamkeit als messbarer Veränderung und Wirkung als Analyse des Wirkmechanismusses getroffen und eine höchstinformative Übersichtsgrafik über die Hauptarten der Evaluation auf Seite 129 eingebracht), sei es das Selbstmonitoring chronischer Krankheiten (hier werden v.a. computergestützte Verfahren der Selbstbeobachtung beschrieben, aber auch Techniken des Selbstmanagements, und an acht Krankheitsbereichen demonstriert), seien es Public Health-Ansätze (hier werden auf Seite 166 tabellarisch die Bereiche und Zielgruppen der Publik-Health-Ansätze dargestellt von der ökologischen Sicherheit bis zur Unfallverhütung. Seite 168 bietet eine Tabelle zu Beispielen gesundheitsbezogener Verhältnisprävention. Bemerkenswert das im Schlussteil eingebrachte Plädoyer für die Berücksichtigung von Grundwerten) oder sozialepidemiologische Präventionsbeiträge (hier wird insbesondere betont, dass bei Interventionen der gesellschaftliche, kulturelle und soziale Rahmen berücksichtigt werden muss, dass Verhaltensprävention durch Verhältnisprävention ergänzt und unterstützt werden muss. Am Beispiel von Geschlechtsunterschieden und sozialer Ungleichheit wird demonstriert, wie wichtig die Einbeziehung solcher Variablen in Vorsorgemaßnahmen ist).
Der dritte Teil ist der umfangreichste. Auf über 500 Seiten wird die gesundheitspsychologische Prävention als Ressourcenstärkung und Risikoprophylaxe ausgebreitet. Die Darstellung befasst sich mit fünf Aspekten: zunächst geht es um die Prävention von Risikoverhalten wie z.B. Alkoholkonsum, Ernährung, Stress, dann wird die Prävention in verschiedenen Lebensaltern umrissen. Ein weiterer Aspekt befasst sich mit der Ebene von Gruppen und Organisationen (z.B. Familien, Schulen, Gemeinden), gefolgt von einer Überblicksdarstellung von präventiven Maßnahmen bei schweren Erkrankungen und kritischen Lebensereignissen (Thema sind z.B. Asthma, Schmerz, Posttraumatische Belastungsstörungen). Ein abschließender Bereich stellt übergreifende Aspekte gesundheitspsychologischer Prävention dar wie z.B. Rehabilitation, genetische Diagnostik. Der letzte Beitrag in diesem Bereich ist eine feine Note der Herausgeber, ein kleiner Hinweis auf die Notwendigkeit kritischer Selbstreflexion und auf die Notwendigkeit der Angemessenheit und richtigen Dosierung, die ja bekanntlich den Unterschied zwischen Gift und Medikament ausmacht. Es handelt sich um den Beitrag „Healthismus und Lebensqualität“. Beschrieben wird die übersteigerte Beschäftigung mit der Gesundheit. Es geht aber nicht darum, die „staatlich geförderte Hypochondrie“, „die Hygieneautisten“ und „Gesundheitsfanatiker“ ins psychopathologische Eck zu rücken. Es geht um ein übertriebenes präventives Gesundheitsbewusstsein. Eine Tabelle auf S 749 zeigt die unterschiedlichen Haltungen und Lebensstile und ihre Form der Gesundheitsthematisierung auf. Und es werden Alternativkonzepte dargestellt, in deren Mittelpunkt die Lebensfreude steht.
Das Buch hat Wirksamkeit und Wirkung: Es führt zu einem deutlichen Informationsgewinn und zu einem profunden Wissen über wichtige Gesundheitswirkkomponenten und die dementsprechenden präventiven Maßnahmen! Ein wichtiges Buch!