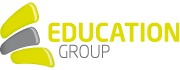Neurobiologie für den therapeutischen Alltag
In diesem Buch kommen 11 Expertinnen und Experten zu Wort und setzen sich mit verschiedenen Themenstellungen im Umkreis der Neurobiologie auseinander: Die Rolle von Liebe, Neugier und Spiel etwa, systemisch und neurobiologisch betrachtet; die Gegenpoligkeit von leistungsorientierter,...
Buchtitel: Neurobiologie für den therapeutischen Alltag. Auf den Spuren Gerald Hüthers.
Autorinnen: Bonney H
Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht
Erschienen: 2011
...fokussierter Aufmerksamkeit und absichtsloser Achtsamkeit; die kritische Betrachtung der "Modediagnose" ADHS, die mit der überraschenden Hypothese von Hüther aufwartet, dass eher eine Dopaminüberschuss vorliegt als ein Dopamindefizit; die Darstellung einer Präventionsstudie, die vor allem vom Wissen um die weitgehende Neuroplastizität getragen zu präventiven Maßnahmen ermuntert; die psychischen und neurobiologischen Folgen von Traumatisierungen in Kindheit und Jugend und die Nutzung des Ansatzes, dass das Gehirn ein soziales Konstrukt darstellt; Ausführungen zum Konzept der Salutogenese und des Kohärenzsinnes nach Antonovsky, sowie Faktoren, die den Einsatz von Musik(therapie) förderlich oder hemmend gestalten können. Die Intentionen der Autorinnen und Autoren werden in einem Inhaltsüberblick im Vorwort eingehend dargelegt.
Einige Schlaglichter sollen nun auf wichtige Thesen und damit auf Diskutierbares im Buch geworfen werden:
Rainer Schwing referiert über die -neurobiologisch nachweisbar - das Lernen intensivierende Bedeutung von Emotionen und über den evolutiven und überlebensmäßigen Vorteil von sieben Basisemotionen. Der Autor greift die Liebe heraus ( hier erwähnt er das Joining der Systemischen Therapie - natürlich hätte vor allem der Pionier der therapeutischen Wärme, Rogers, mit dem Konzept der Wertschätzung eine Erwähnung verdient), weiters die Neugier (hier führt er den Patienten verblüffende therapeutische Techniken wie z.B. das Reframing an) und das Spiel, das mit Spaß und Kreativität lernförderlich wirkt. Immer zeigt er die damit korrespondierenden neurobiologischen Veränderungen auf und kommt damit zu einem die Lernprozesse im psychisch-körperlichen System und im sozialen System verschränkenden Modell für die Praxis ( S 34 Abbildung 3). Dem Empfinden des Rezensenten entsprechend können die vier Prozesse Wahrnehmen, Bewerten, Erklären und Handeln, wie sie im sozialen System ablaufen - und auch im mentalen Bereich, nur indirekt als Bezeichnung für Prozesse in Bereichen der Sensumotorik und der neuronalen Karten angewendet werden, es sind eigene Prozesse, deren personalistische Analogsetzung man durch Anführungszeichen ("Wahrnehmung", "Bewertung" etc.) kennzeichnen müsste. Der abschließend zitierte Leid- oder Leitfaden für Veränderung stammt vom Begründer der Positiven Psychotherapie und handelt von einem Mann, der eine Straße geht, in ein dort befindliches Loch immer wieder hinein fällt und dabei von Mal zu Mal dazu lernt, bis er schließlich eine andere Straße benützt- was leicht - aus dem Kontext heraus gerissen- als Empfehlung zum Vermeidungslernen missverstanden werden könnte und sicher nicht der Intention des Autors entspricht.
Bonney gelingt mit seiner Gegenüberstellung von Aufmerksamkeit und Achtsamkeit eine spannende Auseinandersetzung mit diesen grundlegenden orientierungs- und handlungsleitenden Konzepten. Nachvollziehbar ist seine Polarisierung zwischen einer( uhr)zeitorganisierten und einer ereignisorientierten Form der Zeitgestaltung. Ebenso leuchtet die Unterscheidung zwischen einer leistungsfokussierten Aufmerksamkeit und einer erlebnisorientierten Achtsamkeit ein. Diskutierbar ist die Polarisierung in - der Achtsamkeit zuzuordnende - polychrone Ereigniskulturen (man denke an das nicht unbedingt auf Achtsamkeit abzielende event-management) und - der Aufmerksamkeit zuzuordnende -monochrone Zeitkulturen (man denke an das multi-tasking in hochleistungsbetonten Kontexten). Diskutierbar ist auch die Polarisierung zwischen außenorientierter Aufmerksamkeit und innengerichteter Achtsamkeit (S 55), die einzig dem subjektiven Wahrnehmen gewidmet sei ( der Gegensatz besteht doch eher in der fokussierten Aufmerksamkeit und der ungerichteten Achtsamkeit, wobei letztere auch keine Richtung auf nur subjektiv, innerliches Wahrnehmen vorgibt. Außerdem unterscheidet die Meditation ohne qualitativen Sprung gegenstandsgebundene, kontemplative Formen und gegenstandsfreie).
Tschacher und Feuz zeigen, dass die neurobiologische Forschung offen ist für alle Ergebnisse und nicht auf eine unbedingte Selbstbestätigung ausgerichtet ist. Sie demonstrieren das anhand der keine signifikanten differentialdiagnostischen Kriterien erbringenden neuropsychologischen Erforschung der adulten ADHS, die sie eher als Persönlichkeitsstil werten.
Die Frankfurter Präventionsstudie, über die als maßgeblich Beteiligte Leuzinger-Bohleber referiert, bringt eine Fülle von Einsichten in die frühe Arbeit mit Risikokindern - sowohl aus psychoanalytischer Perspektive als auch aus neurobiologischer und liefert konkrete Angebote für frühkindliche Präventionsprogramme wie z.B. das Programm FRÜHE SCHRITTE, das in klassisch hermeneutischer Psychoanalyse die Bedeutung des Fehlverhaltens ans Licht zu bringen versucht; und das Programm FAUSTLOS, das zur Einfühlung in Emotionen anderer und Nachahmung nicht impulsiver, nicht aggressiver Problemlösungen anregt.
Ein letztes Schlaglicht sei noch auf den Beitrag von Reddemann geworfen: Es geht nicht, wie der Titel "Wenn Musiktherapie nicht hilft" nahelegt, um die Grenzen der Musiktherapie (wobei die Konstatierung des Faktums, dass nicht jedes Verfahren für jeden Zweck und für jeden Patienten indiziert ist, nichts Ungewöhnliches oder Unerwartetes darstellt), sondern um biografische Konstellationen, die den das Gehirn harmonisierenden Effekt von spielerischer, angenehm anzuhörender Musik ( S181, ein Zitat von Hüther) in Frage stellen. Es geht um die Beobachtung, dass für Musiker die Ausübung von Musik, z.B. wenn sie seit der Kindheit mit hohen elterlichen Leistungserwartungen verknüpft ist, nicht notwendigerweise heilsam ist. Der Beitrag der Autorin beruht auf einem Vortrag bei einem Kongress, bei dem Musik und Heilung im Mittelpunkt standen und ist in diesem Kontext nachvollziehbarer. Nachdenklich stimmt der behauptete erlebte Selbstverlust von Musikern, wenn sie dem Erwartungszwang von Noten und Lehrern zu folgen haben. Ob dem, wie die Autorin durch Kontakte mit Musikern von diesen erfuhr, immer so ist, darf hinterfragt werden: Die Kunst der Individualisierung besteht ja in der persönlichen Akzentsetzung und Interpretation des Vorgegebenen; ähnlich, wie auch ein Schauspieler nicht wesenlos die durch den Text definierte Rolle erfüllt und die "Textpuppe " nur hin und her bewegt, sondern ihr sein Leben einhaucht. Es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass der "Selbstverlust" nicht ausschließlich Folge des auferlegten Musizierzwanges ist, sondern auch primäre Ausgangsbedingung dafür sein kann, dass man sich nicht mehr von der Schablone lösen kann.
Insgesamt ist der Anspruch, eine Neurobiologie für den therapeutischen Alltag zu liefern, eingelöst durch den Hinweis, dass mit seelischen Veränderungen neurobiologische Prozesse einher gehen, im Gespräch von Besser mit Hüther wird sogar auf "hirnfreundliche" Traumatherapie bzw. Beratung (S148) eingegangen, d.h. der Versuch unternommen, die Psychotherapie nach Kompatibilität mit Hirnprozessen auszurichten. Der Geburtstagsband für Gerald Hüther nimmt die von ihm behauptete Neuroplastizität des Gehirns ernst, lässt aber - durch die Komplexität des Themas unvermeidlich - noch viele Fragen offen, wie der therapeutische Alltag tatsächlich von neurobiologischen Erkenntnissen profitieren kann. Das Buch erweckt Neugier auf die weitere Erforschung des neuen und doch so alten Problems der Beziehung zwischen Gehirn und Seele!
Das Buch ist gut zu lesen und fernab von jedem neurobiologischen Missionarismus: Die Offenheit Hüthers für die Anerkennung psychologischer, pädagogischer, psychotherapeutischer Heilungs- und Verständniswege neben und in Verbindung mit neurobiologischen Forschungspfaden ist exemplarisch.