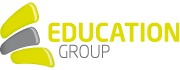Sexuelle Gewalt – Wie Lehrkräfte SchülerInnen helfen können
Medienberichte über die Aufdeckung von sexueller Gewalt in Familien, Schulen, Arztpraxen, Sportvereinen oder in der Popkultur zeigen, wie „aktuell“ dieses Thema ist und verunsichert viele Eltern, aber auch Pädagog*innen, Trainer*innen und viele andere Professionen, die mit Kindern arbeiten.
Durch eine Ent-Tabuisierung des Themas, durch das Aneignen von wichtigen Informationen, können wir – die Erwachsenen – unsere Kinder besser vor Übergriffen schützen. Die Auseinandersetzung mit dem Thema ist herausfordernd, eröffnet aber auch Handlungsmöglichkeiten und macht Mut. Gute wirkungsvolle Prävention darf keine Angst machen: sie stärkt Kinder, fördert die Aufmerksamkeitskultur im Umfeld von Kindern und sie vermittelt Sicherheit im Umgang mit Verdachtsmomenten.
Im schule.at Interview spricht Katja Dienstl vom Verein PIA über sexuelle Gewalt und wie Lehrkräfte Schülerinnen und Schüler helfen können.
Katja Dienstl, MA ist Sozialarbeiterin und leitet den Präventions- und Interventionsbereich beim Verein PIA – Prävention, Beratung und Therapie gegen sexuelle Gewalt. Sie ist Referentin für 100% Sport- für Respekt und Sicherheit – gegen sexualisierte Übergriffe im Sport.
Wovon sprechen wir überhaupt, wenn wir von sexueller Gewalt sprechen?
Den meisten Menschen kommen bei dem Wort „sexuelle Gewalt“ erst einmal Gedanken wie z.B. Vergewaltigung, Kindesmissbrauch oder sexuelle Belästigung in den Kopf, mit den persönlich aufgeladenen Bildern und Geschichten dazu.
Sexuelle Gewalt bezieht sich grundsätzlich auf alle erzwungenen sexuellen Handlungen. Wir (Verein PIA und viele andere Präventions- und Opferschutzeinrichtungen) verwenden den Begriff „sexualisierte Gewalt“, weil er noch viel weiter geht und immer alle Formen der Machtausübung, die mit den Mitteln der Sexualität umgesetzt werden, miteinschließt. Damit beginnt sexualisierte Gewalt schon viel früher, z.B. bei persönlichen Grenzverletzungen, die durch Worte, Bilder, Gesten und Handlungen verursacht werden. Wo diese Grenze ist, ist sehr unterschiedlich und individuell. Was für die eine Person noch lustig oder in Ordnung ist, kann für eine andere Person eine massive Grenzüberschreitung darstellen.
Wer entscheidet dann, was Gewalt ist bzw. wo sie beginnt?
Natürlich sind Gewaltdelikte im Strafgesetz geregelt. Aber trotz dieser Regelungen bleibt oft unklar, was in Ordnung ist und was nicht. Außerdem gibt es einen großen Graubereich, wenn wir von sexualisierter Gewalt sprechen: Manches wäre bereits strafrechtlich relevant, kleinere Grenzüberschreitungen werden aber kaum angezeigt oder die Strafverfahren werden eingestellt. Auch die Werte und Normen in einer Gesellschaft oder Community spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht Grenzüberschreitungen oder Gewalt zu definieren.
Ein ganz wesentlicher Hinweis für Gewalt ist, dass jemand Schaden nimmt, verletzt wird oder unter einer Situation leidet. Grundsätzlich kann immer nur die betroffene Person entscheiden, ob es sich für sie um eine übergriffige Situation handelt oder nicht.
Können diese Einschätzung auch Kinder oder Jugendliche treffen oder sollten dies die Erwachsenen übernehmen?
Für den Schutz der Kinder sind grundsätzlich immer die Erwachsenen zuständig. Auch eine Einschätzung darüber, was in Ordnung ist oder nicht, sollte von verantwortungsbewussten Erwachsenen getroffenen werden. Kinder, die von klein auf missbraucht werden, können so eine Einschätzung - ob etwas normal ist, oder nicht – nicht, oder nur sehr schwer vornehmen. Aber auch ältere Kinder oder Jugendliche, die sexualisierte Übergriffe erfahren, spüren zwar, dass hier etwas nicht stimmt, doch die vielen verschiedenen ambivalenten Gefühle, die durch das Verhalten des*der Täter*in ausgelöst werden, machen eine Einschätzung schwierig.
Können Sie ein paar Zahlen nennen? Von wie vielen Fällen sprechen wir? Wie relevant ist das Thema? Gibt es Studien dazu?
Ja diese Studien gibt es. Allerdings muss ich vorweg sagen, dass hier die Wissenschaft auch an ihre Grenzen stößt. Manche Studien arbeiten mit dem Hellfeld, d.h. mit den angezeigten Fällen. Man geht aber davon aus, dass das Dunkelfeld viel höher ist.
Führt man Interviews zu Gewalterfahrungen mit einer bestimmten Gruppe von Menschen durch, so kann man auch hier nicht von eindeutigen Ergebnissen sprechen: Es beginnt bei der Schwierigkeit was die subjektive Definition und Beurteilung von sexualisierter Gewalt ist. Des Weiteren verdrängen viele Betroffene diese Erfahrungen und können sich nicht mehr daran erinnern.
Die Zahlen sind in den Studien relativ ähnlich. Die Unicef (Quelle: Unicef, 2014) geht in ihrem Bericht davon aus, dass weltweit jedes vierte Mädchen und jeder achte Junge in der Kindheit oder Jugend mindestens einmal Opfer eines sexuellen Übergriffs wird. In Österreich gab es im Jahr 2016 rund 1.200 Verurteilung wegen Delikte gegen die sexuelle Integrität und Selbstbestimmung. Davon waren rund 900 Opfer Kinder und Jugendliche (Quelle: Statistik Austria, 2016).
Eine Zusammenfassung aus 39 Prävalenzstudien aus 29 Ländern ergibt, dass 10-20 % der Mädchen und 5-10% der Knaben von sexueller Gewalt betroffen sind. Wir müssen aber davon ausgehen, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher ist, da es oftmals zu keiner Anzeige kommt. Es wird vermutet, dass heute in jeder Schulklasse zwei Kinder sitzen, die von sexueller Gewalt betroffen sind. Studien und Zahlen sind meist für Geldgeber oder Entscheidungsträger relevant. Wir sind der Meinung, dass jede*r Betroffene es verdient hat, Beachtung zu finden und Hilfe zu bekommen.
Täter*innen wenden eine immer gleiche oder sehr ähnliche Strategie an, um an Kinder zu kommen und um sicher zu stellen, dass der Missbrauch nicht aufgedeckt wird.
Sie haben vorhin das Verhalten von Täter*innen angesprochen. Bedeutet das, dass Menschen, die Kinder missbrauchen ein bestimmtes, gleiches Verhalten haben?
Das immer gleiche Verhalten würde ich nicht sagen. Aber Täter*innen wenden eine immer gleiche oder sehr ähnliche Strategie an, um an Kinder zu kommen und um sicher zu stellen, dass der Missbrauch nicht aufgedeckt wird. Diese Strategien konnten durch Aussagen von Betroffenen eruiert werden, aber auch durch die Aussagen von Täter*innen. Manche nennen diese Strategien auch das „Geschick des Täter’s* der Täterin“.
Auch im Darknet findet man Anleitungen dafür. Das klingt sehr perfide und krank. Kennt man allerdings diese Strategien kann es helfen, zu verstehen, warum Kinder sich nicht einfach jemanden anvertrauen können. Außerdem trägt dieses Wissen dazu bei, Grenzverletzungen im eigenen Umfeld aufmerksamer und kritischer zu betrachten. Und natürlich hilft es auch uns, ständig an unserem Präventionskonzept zu arbeiten und es weiter zu entwickeln.
Können Sie diese Täter*innen-Strategien kurz beschreiben? Und auch, was die Gründe dafür sind, dass jemand ein Kind missbraucht.
Zu allererst braucht es einen Auslöser dafür, dass eine Person sich dafür entscheidet, sexuell übergriffig zu werden bzw. ein Kind zu missbrauchen. Viele denken dabei bestimmt daran, dass der*die Täter*in als Kind selbst missbraucht wurde. Dies trifft allerdings nur auf gut ein Drittel zu. (in der Literatur gibt es dazu verschiedene Zahlen).
Viele Täter*innen haben in irgendeiner Form Gewalt oder Vernachlässigung erlebt, häufig mussten sie viele Beziehungsabbrüche ertragen. Bei manchen handelt es sich aber auch schlicht weg um erlerntes Verhalten in der Kindheit und Jugend: Grenzenlosigkeit in Familie, d.h. die Grenzen des Kindes wurden nicht respektiert, keine Konsequenzen bei Grenzüberschreitungen usw.
Wenn die Idee entstanden ist, ein Kind zu missbrauchen, muss sich der*die Täter*in natürlich noch die Erlaubnis dafür geben. Das kann man sich in etwa so vorstellen, als würde jemand im Geschäft etwas stehlen wollen: Er*Sie gibt sich schon davor die Erlaubnis dafür, geht dann in den Laden und checkt die Lage: Wie viele Angestellte sind heute hier? Ist der Laden-Detektiv in der Nähe? Wie viel ist sonst so los? usw. Ist die Situation günstig, nützt er*sie das aus.
Ähnlich ist es bei Missbrauch: Die Menschen suchen sich häufig Berufe oder auch Freizeitbeschäftigungen aus, in denen sie viel mit Kindern zu tun haben. Sie machen sich dort beliebt, sind Idole für die Kinder aber auch für die Eltern. Ist das Umfeld soweit stabil, beginnen diese Personen Grenzen zu verschieben und testen die Kinder durch leichte, teilweise sehr subtile Grenzüberschreitungen: Welches Kind wehrt sich? Welches Kind erzählt seinen Eltern davon? Welches Kind holt Hilfe? Und welches Kind lässt sich alles gefallen? Das Umfeld wird manipuliert und das Kind wird zunehmend unter Druck gesetzt. Durch Drohungen wird das Kind zum Schweigen gebracht. Wird der Missbrauch aufgedeckt, haben Täter*innen oft gute Begründungen dafür.
Das klingt so, als könnte man niemandem vertrauen?
Es geht uns keinesfalls darum Angst zu schüren und Kinder zuhause einzusperren. Ich möchte eher ein gesundes Misstrauen gegenüber einer gewissen Naivität fördern, eine Aufmerksamkeitskultur entwickeln. Ich darf mir als Elternteil durchaus das Recht nehmen, beim Sporttraining dabei zu bleiben oder einfach mal so reinzuplatzen. Ich kann auf unangemessene Aussagen oder Grenzüberschreitungen von Betreuungspersonen meiner Kinder hinweisen. Ich kann bei Freizeitvereinen nachfragen, welche Qualifikationen die Betreuungspersonen haben und ob diese Personen einen erweiterten Strafregisterauszug vorweisen müssen. Ich kann nachfragen, was in einer Einrichtung gegen Übergriffe, Gewalt und Mobbing getan wird.
Ich darf also auch einmal lästig und unbequem sein. Damit setzt man auch ein Zeichen: „Ich bin aufmerksam, ich sehe nicht weg…“ Und man fordert damit auch andere Erwachsene auf, sich mit dem Thema auseinander zu setzen und Maßnahmen zum Schutz der Kinder einzuleiten.
Die Geschichte vom bösen Mann, der hinter der Schule lauert, ist die absolute Seltenheit. Die meisten Übergriffe (etwa 70-90%) finden in der Familie und im sozialen Umfeld statt.
Was kann man noch tun um Kinder zu schützen?
Die meisten Eltern tun sich sehr leicht damit, dem Kind zu erklären, dass es nicht mit Unbekannten mitgehen darf usw., d.h. es wird Angst vor Fremden geschürt und die Kinder begreifen und spüren sehr gut, dass dies ernst gemeint ist. Allerdings ist die Geschichte vom bösen Mann, der hinter der Schule lauert, die absolute Seltenheit. Die meisten Übergriffe (etwa 70-90%) finden in der Familie und im sozialen Umfeld statt. Man kann die Kinder nicht schützen, indem man ihnen Angst macht, sondern indem man sie stärkt, und das möglichst von Geburt an.
Wie stärkt man Kinder?
Indem man einen wertschätzenden und freundlichen Umgang pflegt und auf die Bedürfnisse und Grenzen des Kindes achtet. Das heißt nicht, dass wir den Kindern alles erlauben müssen. Wenn ein Kind auf die Straße laufen will, setzte ich eine Grenze und schütze es damit vor einer Verletzung. Auch die Grenzen der Eltern sind schützenswert und wenn mehrere Bedürfnisse aufeinander treffen, kann dies natürlich zu Konflikten führen. In solchen Situationen kann man als Erwachsene*r versuchen wertschätzend und fair zu bleiben.Und wir Eltern dürfen uns auch einmal entschuldigen, wenn wir gemein oder ungerecht waren. Das zeigt dem Kind: auch wir Großen machen Fehler.
Ein weiterer wichtiger Schutzfaktor ist es, wenn Kinder die Erfahrung machen, dass sie selbst wertvoll sind und ihr Körper etwas schützenswertes ist. Ein geläufiges Beispiel für das Gegenteil ist, dass Kinder dazu gedrängt werden, dem Opa ein Bussi zu geben, weil er ein Geschenk mitgebracht hat. Das Kind möchte das nicht, spürt also seine eigene Grenze. Oftmals wird diese natürliche Grenze und das gute Gefühl dafür „abtrainiert“. Kinder, die erfahren, dass Erwachsene diese Grenzen respektieren, Kinder die lernen selbstwirksam zu sein, sind besser geschützt.
Wir alle sind Vorbilder für die Kinder, d.h. Prävention ist auch eine Frage der Haltung: Wie gehe ich selbst mit meinem Körper und meinen Bedürfnissen um? Wie spüre und setzte ich selbst Grenzen? Wie zeige ich Gefühle? Wie gehe ich mit anderen Menschen und deren Grenzen um?
Woran erkenne ich, dass ein Kind betroffen ist und was ist dann zu tun?
Leider gibt es keine eindeutigen Zeichen für einen Missbrauch. Körperliche Verletzungen sind selten vorhanden oder sichtbar. Jegliche Verhaltensänderungen bei einem Kind, sind ein Zeichen dafür, dass etwas nicht in Ordnung ist. Manche Kinder ziehen sich zurück, wirken depressiv, andere reagieren immer aggressiver. Auch Veränderungen im Äußeren können ein Zeichen sein, z.B. Gewichtsveränderungen oder Verwahrlosung, d.h. ein Kind wäscht sich nicht mehr.
Psychosomatische Beschwerden wie z.B. Bauchschmerzen, Kopfschmerzen oder Schlafstörungen sind weitere Hinweise dafür, dass es dem Kind nicht gut geht. Das alles können Anzeichen für einen Missbrauch sein, es kann aber auch viele andere Gründe geben, warum ein Kind diese Symptome zeigt, z.B. die Trennung der Eltern, Streit mit der besten Freundin, psychisch erkrankte Elternteile uvm.
Betroffene Kinder holen bis zu 6 mal Hilfe, bis ihnen geglaubt wird.
Wie reagiere ich als Pädagog*in oder auch als Elternteil darauf?
Wenn eine erwachsene Person sich Sorgen um ein Kind macht, sollte sie diese Sorgen nicht verdrängen, sondern das Kind – ohne eine konkrete Vermutung – ansprechen und nachfragen: „Mir fällt in letzter Zeit auf, dass du so ruhig bist. Ich mache mir Sorgen und frage mich, ob es dir gut geht. Kann ich etwas für dich tun? Möchtest du mir etwas erzählen?“ Und auch wenn das Kind nicht sofort erzählt, kann man damit dem Kind zeigen: „Ich bin für dich da, wenn du etwas brauchst. Ich sorge mich um dich. Du bist mir wichtig.“ Erzählt das Kind, heißt es ruhig bleiben und aufmerksam zuhören.
Einer der wichtigsten Merksätze lautet: Glauben Sie dem Kind! Aussagen wie: „Das kann ich mir nicht vorstellen.“ sind unangebracht. Laut Studien müssen sich betroffene Kinder bis zu 6 mal Hilfe holen, bis ihnen geglaubt wird.
Nachbohrende Fragen können äußerst unangenehm für das Kind sein. Deshalb sollte man Warum-Fragen oder Fragen, die eine Erklärung verlangen vermeiden. Wichtig ist es dann, alle weiteren Schritte mit dem Kind zu besprechen, z.B. „Ich rufe im Kinderschutzzentrum an und erkundige mich, was jetzt zu tun ist. Sobald ist etwas weiß, komme ich auf dich zu.“ Man kann sich auch für das Vertrauen des Kindes bedanken und den Mut ansprechen und anerkennen, den es dafür braucht.
Und wenn das Kind nicht gleich erzählt, der Verdacht aber bleibt?
Es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich als Pädagog*in Notizen zu machen über Beobachtungen und Auffälligkeiten. Bei Unsicherheiten oder „komischen Gefühlen“ kann es auch hilfreich sein, eine Beratung beim zuständigen Kinderschutzzentrum in Anspruch zu nehmen. Außenstehende, geschulte Personen können beim Sortieren der Wahrnehmungen und Gefühle helfen und auch die nächsten Schritte besprechen.
Sollte man als Pädagog*in nicht vorher mit den Eltern sprechen?
Das kommt darauf an: Hat man den Verdacht, dass der Missbrauch durch ein Mitglied der Familie stattfindet, sollte man sich direkt an das Kinderschutzzentrum und in weiterer Folge auch an die Kinder- und Jugendhilfe wenden. In anderen Fällen kann mit den Eltern darüber gesprochen werden. Auch die Eltern können sich dann direkt an das Kinderschutzzentrum wenden, um den Schutz des Kindes zu gewährleisten.
Und warum nicht gleich zur Polizei?
Die Aufgabe der Polizei ist es, den*die Täter*in zu stoppen. Die Aufgabe des Kinderschutzzentrums und der Kinder- und Jugendhilfe ist das Wohl des Kindes zu wahren. Eine Anzeige ist für die meisten Menschen keine Routinehandlung. Das Kinderschutzzentrum unterstützt dabei, arbeitet im Tempo des Kindes und stellt bei Bedarf juristische und psychologische Prozessbegleitung zur Verfügung.
Wer ist nun für den Schutz der Kinder zuständig? Schule oder Eltern?
Die Verantwortung für den Schutz der Kinder tragen grundsätzlich immer die Erwachsenen. Je mehr Erwachsene sich dafür zuständig fühlen, umso eher können Kinder auch geschützt werden. Das Zuständigkeitsgefühl zeigt sich auch dadurch, dass Erwachsene ganz klar Position beziehen gegen Gewalt und durch die Solidarität und Unterstützung für Betroffene.
Schule stellt natürlich durch die Schulpflicht schon ein besonderes Setting dar, um zum Kinderschutz beizutragen, da ja so gut wie alle Kinder erreicht werden. So kann Schule auch ein Schutzraum – „ein sicherer Ort“ - für Kinder sein, denen es Zuhause nicht so gut geht.
Welchen Beitrag kann eine Schule präventiv leisten?
Ein gelebtes Präventions- und Schutzkonzept an jeder Schule würde Sinn machen. Darin sollte nicht nur geregelt sein, wie im Verdachtsfall vorgegangen wird und wer die zuständigen Ansprechpartner*innen sind. Neben einem „Erste-Hilfe-Plan“, sollten auch noch Fortbildung- und Qualifizierungsmöglichkeiten zur Erweiterung des Wissens und der Handlungskompetenz zu diesem Thema festgehalten und regelmäßig absolviert werden.
Spezielle Angebote für Mädchen, Buben und für die Eltern (z.B. Elternabende mit Vorträgen zu diesem Thema) sind unterstützend für eine erfolgreiche Umsetzung. Im besten Fall beinhaltet so ein Schriftstück auch ein Sexualpädagogisches Konzept, dass von allen im Team mitgetragen wird. Wenn Sexualität ein offenes Thema in einer Einrichtung ist – und natürlich auch zuhause – ist es im Allgemeinen auch leichter über sexuelle Übergriffe zu sprechen.
Viele Betroffene berichten später, dass sie sich keine Hilfe holen konnten, weil sie einfach keine Sprache dafür hatten, was Ihnen passiert ist. Auch eine geschlechtersensible Erziehung erweitert die gängigen Klischees, wie Mädchen/Frauen* oder Burschen/Männer* zu sein haben und eröffnet damit neue Handlungsspielräume für die Kinder, z.B. auch Burschen dürfen Gefühle zeigen, sich Hilfe holen oder auch Mädchen können sich durchsetzen und Grenzen setzen, müssen nicht zu allem Lächeln und gute Miene machen usw.
Eine bedürfnis- und bindungsorientierte Erziehungsform in der Schule, klare Regeln und Strukturen, die einen grenzachtenden Umgang fördern, Partizipationsmöglichkeiten und Beschwerdestellen für die Kinder, das alles sind präventive Maßnahmen und machen die Schule zu einem sicheren Ort.
Sexualpädagogik als Schutzfaktor? Gibt es nicht sowieso schon ein zu viel an Sex in unserer Gesellschaft? Müssen wir die Kinder nicht eher davor schützen?
Das stimmt: Auf jedem Werbeplakat finden wir heute sexuelle Botschaften. Auch die neuen Medien machen es für Kinder leider sehr leicht, auf einschlägige Seiten zu kommen – wenn auch oft unfreiwillig. Wir können die Kinder auch nicht davor schützen, aber Kinder brauchen dann verlässliche Ansprechpartner*innen, mit denen sie das Gesehene besprechen können.
Bleiben diese Informationen unreflektiert in den Köpfen der Kinder hängen, kann das negative Auswirkung auf die Entwicklung der Kinder haben. Gerade weil diese Bilder heute so schnell verfügbar sind, braucht es die Möglichkeit für eine Auseinandersetzung. Das kann von den Eltern aber natürlich auch von der Schule übernommen werden. Im besten Fall von beiden!
Sexualität ist ein zentraler Bestandteil unserer Identität: Das hat mit mir und meinen Körper zu tun, mit sozialen Phänomenen, mit Liebe und Gefühlen, Moral und Ethik, Verhütung, Krankheiten und vielem mehr. Somit könnte Sexualität im Turnunterricht genauso eine Rolle spielen, wie in Religion, Deutsch oder im Sachunterricht.
Was könnten Herausforderungen für Schulen im Zusammenhang mit der Sexualaufklärung sein? Welchen Anteil haben die Eltern?
Sexualaufklärung löst nicht selten auch Konflikte mit den Eltern aus, die Angst haben, dass durch das Reden über Sexualität die Kinder noch mehr „sexualisiert“ werden oder die Kinder damit nur auf dumme Gedanken gebracht werden. Hier braucht es eine gute Erziehungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern und natürlich auch wieder das Wissen um diese Themen.
Unsere Erfahrung zeigt, wenn die Zusammenhänge zwischen Aufklärung und Schutz verstanden werden, sind alle Eltern damit einverstanden. Aber natürlich sind auch die Eltern für die Sexualerziehung zuständig. Generell gilt: Je kleiner die Kinder, desto eher sollten die Bezugspersonen in der Familie diese Themen übernehmen. Das beginnt z.B. mit dem Benennen der Geschlechtsteile bei Babys in der Wickelsituationen oder der Beantwortung von Fragen wie z.B. „Wie kommt ein Baby in den Bauch“ und „Wie kommt es da wieder raus?“, wenn die Kindergartenpädagog*in plötzlich ein Baby erwartet.
Die Erfahrung zeigt: mit zunehmendem Alter wollen Jugendliche häufig nicht mehr mit ihren Eltern über Sex reden. Dann wäre es schön, wenn andere Personen dies übernehmen würden. Die Lehrerin oder der Lehrer wären da eine Option, allerdings müssen diese auch für alle anderen Leistungen Noten vergeben und bewerten. Das kann es für Kinder und Jugendliche schwer machen, offen über die Themen zu reden, die sie gerade beschäftigen. Wichtig ist auch zu sehen, dass Pädagog*innen schon mit sehr vielen schwierigen Themen konfrontiert sind. Deshalb braucht es eine gute Unterstützung und Begleitung!
Wie kann so eine Unterstützung aussehen?
Durch externe Expert*innen, wie z.B. Sexualpädagog*innen, die mit Kindern, Pädagog*innen und Eltern arbeiten. An Schulen geschieht dies meist in Form von Workshops, die aber nur zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt werden. Die Fragen und Themen der Kinder verändern sich aber laufend, deshalb wäre es gut, wenn es neben den Workshops noch andere Möglichkeiten gibt, Fragen zu stellen, z.B. durch regelmäßige Besuche von geschulten Betreuungslehrer*innen, Sozialarbeiter*innen oder eben Sexualpädagog*innen, die bereits einen Workshop mit den Kindern absolviert haben und den Kindern bekannt sind.
Tatsache ist, dass es vielen Erwachsenen schwer fällt über Sexualität zu reden – auch Eltern mit ihren eigenen Kindern. Ein Abend an der Schule, der dem Beantworten von Kinderfragen gewidmet ist, begleitet von Sexualpädagog*innen könnte Abhilfe schaffen. Es gibt bereits viele gute Kinderbücher, die es den Eltern erleichtern können, „darüber“ zu reden. Die Präventionsvereine in den einzelnen Bundesländern bieten vielfältige Konzepte zur Unterstützung von Schulen und Eltern an – fragen Sie nach!
Gute Prävention ist immer Ermutigung zum Leben. Sie macht nicht Angst davor, auch nicht vor einzelnen Aspekten und Ereignissen, sondern sie vermittelt Sicherheit in möglichen Gefahren (Urs Hofmann).
Beratung und Hilfe
- Raht auf Draht: 147
- Kinder- und Gewaltschutzzentren vor Ort
Präventionsarbeit in Österreich
- Oberösterreich: Verein PIA – Prävention & Intervention, Beratung und Therapie bei sexueller Gewalt
- Steiermark: lil* - Zentrum für Sexuelle Bildung, Kommunikations- und Gesundheitsförderung
- Wien: Verein Selbstlaut
- Salzburg: Selbstbewusst - Verein für Sexualpädagogik und Prävention von sexuellem Kindesmissbrauch
- Vorarlberg: Verein Amazone
Quellen und Downloadmaterial
Verein Selbstlaut: Publikationen und Materialien zum Downloaden gegen sexualisierte Gewalt an Kindern und Jugendlichen, Fortbildungen für Pädagog*innen
Kinderschutzzentrum Möwe: Viel Wissenswertes und Tipps aus dem Kinderschutzzentrum Möwe + Fachartikel der jährlichen Fachtagungen
Plattform Sexuelle Bildung Österreich
Trau dich! Deutschlandweite Initiative gegen sexuellen Missbrauch
Zanzu, mein Körper in Wort und Bild - Barrierefreie Seite rund um das Thema Körper, Sexualität, Rechte, Beziehungen uvm. in vielen verschiedenen Sprachen
Raht auf Draht: Infos für Eltern, Pädagog*innen und Kinder rund um die Themen Pubertät, Sexualität, Beziehungen, Internet, Schule, Gewalt uvm.
Telefonische Beratung (147) möglich!
Literaturempfehlung
Enders, Ursula: Grenzen achten – Schutz vor sexuellen Missbrauch in Institutionen – ein Handbuch für die Praxis.
Miosga, Margit; Schele, Ursula: Sexualisierte Gewalt und Schule – Was Lehrerinnen und Lehrer wissen müssen.
Andresen, Sabine; Gade, Jan David; Grünewalt, Katharina: Prävention sexueller Gewalt in der Grundschule. Erfahrungen, Überzeugungen und Wirkungen aus Sicht von Kindern, Eltern, Lehr- und Fachkräften.
Raffauf, Elisabeth: So schützen Sie ihr Kind vor sexuellem Missbrauch – Prävention von Anfang an.
Der Verein PIA – Prävention, Beratung und Therapie gegen sexuelle Gewalt ist ein gemeinnütziger unabhängiger Verein, der vor über 20 Jahren gegründet wurde. Jährlich bietet der Verein PIA beinahe 100 Präventionsworkshops in Schulen an, hält Fortbildungen und Fachvorträge für Erwachsene, unterstützt Schulen und Institutionen bei Vorfällen und begleitet bei der Implementierung für Präventions- und Schutzkonzepte. Für betroffene Erwachsene werden in Oberösterreich kostenlose Therapieplätze bei Traumatherapeut*innen angeboten. Im letzten Jahr hat das Therapeut*innen-Team rund 1.800 Therapiestunden mit Betroffenen durchgeführt und so diesen Menschen ein Stück weit zu einem selbstbestimmteren Leben verholfen. Zusätzlich zu den Therapien gibt es die Möglichkeiten für anonyme und persönliche Beratungsgespräche, welche häufig ein erster Einstieg in eine therapeutische Versorgung sind. Der Verein PIA ist Mitglied bei der Plattform gegen Gewalt in der Familie des Bundeskanzleramtes für Frauen, Familie und Jugend und bei der Plattform Sexuelle Bildung.